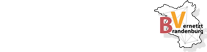Neues aus Calau
Ein bisschen Spaß muss sein, darf auch hohl sein: In der brandenburgischen Kleinstadt wurden im 19. Jahrhundert die Kalauer erfunden. Jetzt gibt es einen Witzerundweg. Holger Kreitling ist ihn abgegnagen.
Witze zu erzählen ist bekanntlich eine schwierige Angelegenheit. Wer dazu aufgefordert wird, nutzt in der Regel zwei Ausweichmöglichkeiten. Die erste: "Ich kann mir überhaupt keine Witze merken", begleitet von einem bedauernden Kopfschütteln.
Die zweite: "Ich kenne nur Witze, die ich Ihnen gar nicht erzählen kann", das verstehe man doch sicher. Dazu gehört ein leicht gesenkter Kopf. So weit die Witz-Theorie. Wer nun von Berlin aus hundert Kilometer fährt, kommt an ein Ortsschild mit der Aufschrift "Willkommen in der Stadt der Kalauer". Der Ort heißt Calau. Born des Flachwitzes, Quell des flapsigen Sprachspiels. In Calau sind einst die ersten und echten Kalauer entstanden. Hier muss doch jeder Einwohner praktisch aus Lokalpatriotismus etwas zu sagen haben.
Das passt: Witz komm' raus, Du bist von Kalauern umgeben.
Kurz vor dem Marktplatz stehen die Kinder von Calau. Sie wollen ihre Witze loswerden. Zuerst singt Julia (6) ein Spottlied aus dem Ersten Weltkrieg: "Herr Meier kam geflogen auf einem Fass Benzin / Da dachten die Franzosen, er sei ein Zeppelin / Sie luden die Kanonen mit Sauerkraut und Speck / Und schossen dem Herrn Meier die Unterhose weg." Frau Hirsch, die Kindergärtnerin, hat es ihr beigebracht. Niklas (6) druckst herum, bis klar wird, dass er - Variante eins - sich keine Witze merken kann. Dann hebt ein weiteres Mädchen aus Calau an und erzählt mit klarer Stimme von Onkel Fritz, der in der Badewanne sitzt. Der Rest ist nicht leichtherzig zu drucken und fällt unter Kategorie zwei.
Schnell jetzt zur Hebung der allgemeinen Laune einen echten Kalauer dazwischen schieben: "Wo wohnt die Katze? Im Miezhaus." Ja, das tut weh, nicht wahr? Am ehemaligen Haus des Korbmachers in der Kirchstraße prangt eine Tafel, da steht: "Warum hat Korbmacher Krause keine Haare mehr auf dem Kopf? Weil die Afrikaner ,Krauses Haar' haben!"
Calau in der Niederlausitz ist stolz auf seine Tradition. Am Eingang zum Rathaus hängt ein blauer Briefkasten mit der Aufschrift Witzpost. Da werfen die Einwohner Witze rein, die sie gehört haben. Später werden sie im Amtsblatt der Stadt gedruckt, neben den Sprechstunden der Schiedsstelle, den Öffnungszeiten des Frauenbegegnungszentrums und der öffentlichen Bekanntmachung des Bodenordnungsverfahrens Schlabendorf/Zinnitz. Etwa so: "Was zeigt man einer Frau, wenn sie zwei Jahre unfallfrei Auto gefahren ist? Den zweiten Gang." Die neue Attraktion von Calau ist der Witzerundweg, überall im Zentrum hängen Tafeln mit richtigen Kalauern und ein paar Erklärungen über die Historie der Häuser. Noch einen? Aber klar. "Warum haben in Calau so viele Häuser und Schuppen Flachdächer? Damit die Hypotheken besser aufgelegt werden können!"
Der Ruf des Kalauers als Witzform ist schlecht. Kaum jemand bekennt sich zu Mario Barth, obwohl er die Hallen füllt. Fips Asmussen, der König des schnellen und grottigen Witzes, lässt die Vernunftbegabten unter uns aufheulen. Kalauer verleiten zum Fremdschämen. Selbst im "Stern" gibt es die Rubrik "Neues aus Kalau" nicht mehr. 2005 wurde der Name abgeschafft, obwohl das Spaßniveau gleichbleibend gehalten wird. Die Deutschen haben sich mit vielem arrangiert und ausgesöhnt, aber unter Niveau gelacht wird immer noch ungern. Nur zu Karneval werden die ollen Kamellen aus der Humorkiste geholt und als neu verkauft. Eigentlich schade.
Die echten Kalauer sind gar nicht so witzig, hört man in Calau oft. Das ist nun nicht zu leugnen. Kalauer fliegen tief. Kalauer sind hohl. Meist muss man sich winden, will "Uuuuuuh" oder "Huarrg" rufen und dann sofort über schlechten Geschmack philosophieren. Die Calauer ficht das nicht an. Frank Böttner spricht von Spitzfindigkeit, von Derbheit, von Doppeldeutigkeit, die den Kalauer auszeichnen. "Wir behaupten fest: Die gibt es nur bei uns." Er ist Calaus stellvertretender Bürgermeister, sieht ein bisschen aus wie Bernd Stromberg, Schadensregulierer aus "Stromberg". Nur herzlicher. Böttner lacht gerne. "Jeder Blondinenwitz von Mario Barth ist keen Kalauer, das muss man ganz deutlich sagen", ruft er. Patriotismus kennt also Lachgrenzen. Obwohl Böttner ein Zugereister ist. Er kommt von Usedom, hatte dort mit Tourismus zu tun. Vom "Grauen Gold" erzählt er, Touristenbusse mit Senioren, die gut und gerne 2000 Jahre zusammenbringen, und die bisher nur im Spreewald halten. Sie sollen auch mal nach Calau reisen und aussteigen.
Was ist sein Lieblingswitz?
Der stellvertretende Bürgermeister wählt Variante eins. Kann sich Witze nicht merken, leider. Seinen Lieblings-Kalauer kennt er aber. "Was ist an der Knackwurst am wertvollsten? Das N!"
Schweigen.
"N wie Nordpol", sagt Böttner.
Ratlosigkeit macht sich weiter breit.
"Sonst hieße es doch, Entschuldigung, Kackwurst." Und als unsere Gesichter sich aufhellen: "Sehen Sie, Kalauer sind manchmal gar nicht so leicht zu verstehen."
Noch schlägt sich der Kalauer-Ruhm nicht in der Calauer Wirtschaftsbilanz nieder. Soll aber kommen.
Deshalb steht draußen ein Langhaariger mit karierter Kappe und gestreiften Hosen. Über den Schultern trägt er zwei geputzte Stiefel. Stephan Uhlig ist als Schusterjunge von Calau verkleidet und weiß alles über den Witzerundweg, außerdem ist er Stadtführer und "Tourismusmanager", was als aufgeplustertes Wort vielleicht auch ein Kalauer ist. Calau ist wie so viele brandenburgische Dörfer von überschaubarer Betriebsamkeit. Nicht jeder Bürgersteig müsste wegen Benutzungsgefahr morgens heruntergeklappt werden. Eine kleine Schlange bildet sich am Mittag vor dem Metzger, Soljanka 2,30 Euro, Nudeln mit Tomatensoße 2,40 Euro. Beim Bäcker werden Eisbecher für 2,79 Euro angeboten, ein Plakat verspricht "Mit Kalauern".
Schusterjunge Uhlig, mit 44 Jahren dem Jungenalter entwachsen, führt durch Calau und berichtet erschöpfend von der Geschichte der Stadt. Zu seinem jetzigen Job kam er eher unverhofft. Uhlig arbeitete im Tagebau, war dann Trainer für Tischtennis und für Gesundheit, über seine Arbeit im Heimatverein von Calau kam er zur Verwaltung. Für eine Veranstaltung auf dem Marktplatz zog er sich einmal die Beinahe-Clownskluft an, schwupps, war er engagiert. Die Kalauer an den historischen Plätzen sind überliefert aus dem 19. Jahrhundert. Die Sparkasse hat sich extra einen Neuen überlegt. Es ist ein Stoßseufzer: "Eben haben sie noch zugegeben, noch nie einen 30-Euro-Schein gesehen zu haben, und jetzt behaupten Sie, dieser sei falsch!"
1833 gab es im Ort 120 Schuster. Die Schuhe genossen einen guten Ruf und wurden in Preußen gut verkauft. Die Schusterjungen hatten oft die Nächte über zu tun, um sich wach zu halten, erzählten sie sich Scherze und Witze. Uhlig bleibt vor einem Haus stehen, wo der Wollhändler Meyer Ball gelebt hat. Auf dem Fenstersims sitzt eine Bronze-Figur, mit einer Zeitung in der Hand. Hier machte der Satiriker Ernst Dohm Mitte des 19. Jahrhunderts gerne Urlaub, er schrieb nebenbei und notierte, was die Schusterjungen für neue Flapsigkeiten auf Lager hatten. Zurück in Berlin brachte Dohm die Witze zum "Kladderadatsch", die als wöchentliche Zeitschrift bald in ganz Preußen bekannt war. Die Witze aus Kalau - damals schrieb sich das Dorf mit K - wurden immer beliebter, also musste Dohm neue heranschaffen. Der "Kladderadatsch" druckte die Scherzkeksereien schließlich in einer Spalte mit der Überschrift "Neues aus Kalau". Der Kalauer war geboren. Ohne Schusterjungen wäre der Lachstandort Deutschland ein anderer.
Spaß-Forscher und Sprach-Puristen haben eine zweite Erklärung parat. Demnach leitet sich das Wort Kalauer vom französischen "calembour" ab, das "Wortspiel" oder "fauler Witz" bedeutet. In Calau hört man diese Herleitung nicht gerne. "Da verwahren wir uns entschieden dagegen", sagt der stellvertretende Bürgermeister Böttner.
Neben den Tafeln sind im Stadtbild sechs putzige kleine Schusterjungen verteilt, die jeweils einen Kalauer symbolisieren. Auf dem Marktplatz hat einer der kleinen Kerle eine Weltkugel in den Händen. Eine Frau vom Typus "Graues Gold" nähert sich, streicht über die Kugel. "Na, den werden sie doch abmontieren", seufzt sie. Von der anderen Seite kommt Herr Graues Gold und spricht Uhlig an. "Weeßte, was Vandalismus ist? Wird nicht lange stehen bleiben." Klingt wie ein Kalauer, ist aber auf die Figur gemünzt. Die Stadt wünscht sich, dass es mehr kleine Schusterjungen werden, die Kalauer Bürger fürchten das Gegenteil. Uhlig in seiner Aufmachung seufzt. Im Humorgeschäft auf dem Land muss man mehr Stehvermögen beweisen als Fips Asmussen, der drei Stunden am Stück Zoten raushauen kann.
Calau mit im Kern 6300 Einwohnern steht nicht schlecht da. Es gab keine starke Abwanderung wie in anderen Städten der Gegend, als der Braunkohletagebau eingestellt wurde. Die Arbeitslosenquote liegt um zehn Prozent, das ist Durchschnitt. Calau ist ein Verwaltungsstädtchen, mit Arbeitsplätzen im Finanzamt, Straßenverkehrsamt, bei der Autobahnpolizei. Einer der im Amtsblatt abgedruckten Witze geht so: "Warum können Beamte nicht versetzt werden? Sie werden umgebettet!" Einmal im Jahr wird ein großes Fest gefeiert, der Eröffnungsabend ist Kabarettisten vorbehalten. Die Calauer kommen gerne und lachen mit. Gerade gastiert der "Circus Schollini", Charly und Mario versprechen "lustige Clownerien".
Die Deutschen haben einen enorm schlechten Ruf, was Humor betrifft. Können sie nicht, heißt es. Zu miesepetrig, zu ernst, zu verbissen. Ständig grüblerisch statt offen. Nun haben sie in einer spaßstrukturarmen Gegend wie Brandenburg tatsächlich etwas geschaffen, was Millionen gerne oder auch gerne wider Willen zum Lachen bringt, und dann soll es die falsche Erfindung sein oder aus Frankreich kommen? Ein entschiedenes Nein. Eigentlich müsste Calau seine Kernkompetenz besser ausspielen; es könnte glatt ein Bayreuth des Plattwitzes sein, die allererste Gagfabrik Deutschlands, Heimat der Hohlschmiede und Possenreißer. Aber, ach, der Wille. Der Elan. Der Mut.
Stephan Uhlig zuckt mit den Achseln und spricht über die zurückhaltenden Calauer. "Man darf die Leute nicht überfordern", sagt er. Mehr als der ein oder andere Kabarettabend gehe nun wirklich nicht. Die buschigen Haare unter der Kappe wackeln ein bisschen. Am westlichen Ende des Witzerundwegs steht vor der Praxis der Physiotherapeutin Mandy Hilsky eine Tafel mit der Aufschrift: "Kommt ein Fuchs in den Hühnerstall und ruft: Raus aus den Federn!"
In einer Verwaltungsstadt muss man gehorsamst die Ordnungsmacht aufsuchen. Heiko Trägner ist Wasserschutzpolizist. Calau gehört sein Herz. "Bitte schreiben Sie nicht ,Dorf'!", sagt er. ",Kleinstadt', ja, aber nicht Dorf."
"Kleinstadt mit Witz", sagt Uhlig in seiner Eigenschaft als Tourismusmanager.
Dann soll Trägner, 39, einen Witz erzählen. Könne er nicht, puh, sagt er vorbauend, und nimmt die Polizeimütze ab. Sonne scheint ihm ins Gesicht. "Die Kalauer sind gar nicht so witzig", sagt er. Trägner grübelt, setzt an, schüttelt den Kopf. Er entscheidet sich für Wahlmöglichkeit Nummer zwei: Unanständigkeit. Später fällt ihm doch einer ein, er beginnt mit Fritzchen, der in der Schule sitzt. Bald stellt sich heraus, dass auch dieser Scherz zur zweiten Kategorie gehört und folglich verschwiegen werden muss.
"Was für ein Polizist sind Sie eigentlich?"
"Wasserschutzpolizei", sagt er. Eigentlich gebe es da keine wesentlichen Unterschiede zur Stadtpolizei oder Autobahnpolizei.
"Die Uniform ist schöner. Ansonsten sind wir alle blau", ruft er heiter.
"Aha, doch noch ein Kalauer!"
"Seh'n Sie!"
Der Polizist strahlt. Gelernt ist gelernt. So findet der schöne Nachmittag in der Kleinstadt mit Witz doch noch einen würdigen Abschluss. Es darf gelacht werden.
Quelle: Berliner Morgenpost - Holger Kreitling
Foto: © Reto Klar